Die Tendenz zur Deindustrialisierung Europas wird immer deutlicher – doch Politiker wollen wegen der „russischen Gefahr“ Hochrüstung – wie passt das zusammen?
Euroas Dilemma: Hochrüstung trotz Deindustrialisierung
Nicht nur in Deutschland verstärkt sich die Tendenz der Deindustrialisierung. Das lassen zumindest Analysen wie die der Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) erkennen. Umso erstaunlicher, dass die Mehrheit der Politiker für Hochrüstung eintritt. Abgesehen von dem politischen Ansatz einer „russischen Bedrohung“ für Europa, verkennen die Verfechter offenbar auch die allgemeine ökonomische Leistungsfähigkeit und die Interessengegensätze zwischen den europäischen Staaten.
In einem Artikel in der New York Times vom 27. 06. 2025 wurden einige dieser Probleme verdeutlicht. Ob die vielfach gelobten US-Rüstungsgüter wirklich so gut und kriegstauglich sind und ob die US-(Rüstungs-)Industrie hinreichend Ressourcen und Kapazitäten für die Hochrüstung hat, sei genauso dahingestellt, wie die Finanzierbarkeit durch die europäischen Staaten. Zur Steigerung der Profite und Aktienkurse wird die Initiative auf jeden Fall beitragen. Nachfolgend eine nicht eigene Übersetzung.
Beginn der Übersetzung:
Europas Dilemma: Aufbau einer Militärindustrie oder weiterhin auf die USA angewiesen bleiben
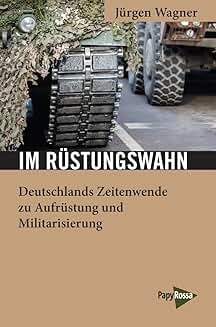 Die Europäer haben sich bereit erklärt, mehr für Waffen auszugeben, und wollen diese Ausgaben im eigenen Land tätigen. Aber können die europäischen Hersteller mit den dominierenden US-Firmen konkurrieren?
Die Europäer haben sich bereit erklärt, mehr für Waffen auszugeben, und wollen diese Ausgaben im eigenen Land tätigen. Aber können die europäischen Hersteller mit den dominierenden US-Firmen konkurrieren?
Die europäischen Länder haben sich verpflichtet, in den nächsten zehn Jahren fast doppelt so viel für militärische Investitionen auszugeben, in der Hoffnung, dass dies ihrer Verteidigungsindustrie zugutekommt.
Es ist jedoch unklar, ob all dieses Geld – möglicherweise bis zu 14 Billionen Euro oder 16 Billionen Dollar – eine Welle von High-End-Innovationen in Europa auslösen wird. Der Grund dafür ist das sogenannte F-35-Problem.
Europa verfügt über keine hochwertigen Alternativen zu einigen der am dringendsten benötigten und begehrtesten Verteidigungsgüter, die von amerikanischen Unternehmen hergestellt werden. Dazu gehört auch die F-35, der berühmte Stealth-Kampfflugzeug von Lockheed Martin, dessen fortschrittliche Fähigkeiten von europäischen Konkurrenten unerreicht sind.
Patriot-Raketenabwehrsysteme werden ebenso aus Amerika importiert wie Raketenwerfer, hochentwickelte Drohnen, satellitengesteuerte Langstreckenartillerie, integrierte Kommando- und Kontrollsysteme, elektronische und Cyber-Kriegsführungskapazitäten – zusammen mit dem Großteil der Software, die für deren Betrieb erforderlich ist.
Und da viele europäische Nationen bereits in amerikanische Waffen investiert haben, möchten sie, dass neue Anschaffungen kompatibel bleiben.
Die zugesagten Investitionen haben zu Spannungen geführt. Sollten die europäischen Nationen ihre eigene Rüstungsindustrie aufbauen? Lassen der Krieg in der Ukraine und die Bedrohung durch ein militarisiertes Russland so viel Vorlaufzeit zu? Oder sollten sie zumindest teilweise weiterhin in die bereits verfügbare Spitzentechnologie Amerikas investieren?
Europäische Beamte, die über die Beantwortung dieser Fragen debattieren, verfolgen eine Mittelwegstrategie. Die Beamten haben Obergrenzen für die Ausgaben für amerikanische Ausrüstung aus bestimmten Geldtranchen festgelegt, darunter das Flaggschiff-Programm der EU zur Verteidigungsfinanzierung – eine Kreditfazilität in Höhe von 150 Milliarden Euro (173 Milliarden US-Dollar) zur Förderung gemeinsamer Beschaffungsmaßnahmen. Die meisten Anschaffungen werden jedoch von den einzelnen Ländern getätigt, die ihre Ressourcen nach eigenem Ermessen verteilen können.
Die Debatte über die Ausgaben ist dringlicher geworden, da die Vereinigten Staaten ihre Unterstützung für die Ukraine zurückfahren. Die Trump-Regierung hat in den letzten Tagen angekündigt, dass sie die Waffenlieferungen dorthin aussetzt, sodass die europäischen Verbündeten einspringen müssen.
Die europäischen Länder haben sich auf dem NATO-Gipfel letzte Woche darauf geeinigt, 3,5 Prozent des jährlichen Nationaleinkommens jedes Landes für harte militärische Investitionen auszugeben, zusätzlich 1,5 Prozent für militärisch relevante Projekte. Die Zusagen der Verbündeten entsprachen der Forderung von Präsident Trump, mehr Verantwortung für ihre Verteidigung zu übernehmen.
Es gibt im Wesentlichen zwei Denkrichtungen, während Europa sich auf eine Welle von Militärausgaben einlässt, sagte Charles Grant, Direktor des Center for European Reform, einem Think Tank, der sich mit der Europäischen Union befasst. Eine Ansicht, die von französischen Beamten und den EU-Institutionen stark vertreten wird, ist, die Verwendung der europäischen Mittel auf die längerfristige Priorität des Aufbaus der europäischen Verteidigungsindustrie zu beschränken. Dies ist besonders wichtig, damit die Europäer nicht übermäßig von einem amerikanischen Verbündeten abhängig sind, dem sie nach Ansicht einiger nicht mehr vertrauen können.
Die andere Ansicht, die von den nordischen und baltischen Staaten sowie Polen geteilt wird, lautet, dass Europa jetzt Fähigkeiten benötigt, um der Ukraine zu helfen, und weniger protektionistisch vorgehen sollte. „Sie glauben, dass wir keine Idealisten sein können, sondern jetzt handeln und jetzt Geld für die Ukraine ausgeben müssen“, sagte Grant.
Beamte in Polen argumentieren, dass die Ansätze miteinander vereinbar sind. Polen ist gemessen am Anteil am Nationaleinkommen eines der Länder in Europa, die am meisten für Verteidigung ausgeben, und kauft seine hochentwickelten Waffen hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten. Da die europäischen Nationen so viel mehr ausgeben werden als bisher, können sie spezialisierte Produkte aus den Vereinigten Staaten kaufen und gleichzeitig in lokale Industrien investieren, so die Beamten.
„Aus unseren nationalen Haushalten werden die meisten europäischen Länder, mit der möglichen Ausnahme Frankreichs, weiterhin einen Großteil ihrer Waffen aus den Vereinigten Staaten beziehen“, erklärte Radoslaw Sikorski, der Außenminister Polens, letzten Monat gegenüber Reportern in Warschau.
Wenn Europa jedoch in der Lage sein muss, sich allein gegen Russland zu behaupten, wie es amerikanische Regierungsvertreter gefordert haben, braucht es laut Sikorski auch eine „verbesserte Verteidigungsindustrie“ mit mehr Kapazitäten.
„Wir können nicht alles aus den Vereinigten Staaten importieren“, sagte Sikorski.
Ein gemischter Ansatz bedeutet, dass Europa wahrscheinlich weiterhin von wichtigen amerikanischen Technologien abhängig bleiben wird. Einige Beamte befürchten, dass Washington eines Tages wichtige Software-Updates zurückhalten könnte, eine Sorge, die durch Trumps zeitweilige Infragestellung der NATO-Verpflichtungen und seinen regelmäßig milderen Ton gegenüber Russland noch verstärkt wird.
Nehmen wir das Beispiel F-35. Der Kauf der 80 Millionen Dollar teuren Jets bedeutet, sich langfristig auf eine Beziehung mit dem Hersteller für Updates festzulegen. Angesichts der jüngsten Schwankungen in der transatlantischen Allianz haben Beamte in Ländern wie Portugal, Kanada und Dänemark die zukünftigen Käufe des Jets in Frage gestellt.
Hier stoßen die europäischen Nationen auf die Realität. Sie haben keine gleichwertige Alternative zu diesem Kampfflugzeug der fünften Generation, das bereits von vielen Ländern eingesetzt wird, und Washington plant die Entwicklung einer sechsten Generation.
Dieses Dilemma erklärt zum Teil die von nordischen und deutschen Beamten vertretene Ansicht, dass Europa gute Beziehungen zu US-Rüstungsunternehmen aufrechterhalten muss, auch wenn die Kommunikation mit Trump angespannt ist, sagte Claudia Major, Sicherheitsexpertin beim German Marshall Fund.
Sie sagte, dass solche Beziehungen Bestand haben werden und dass amerikanische Unternehmen „befürchten, vom wachsenden europäischen Verteidigungsmarkt ausgeschlossen zu werden”.
„Sie wollen im europäischen Spiel bleiben“, sagte sie.
Da die Europäische Union jedoch versucht, zwei Prioritäten in Einklang zu bringen – den Ausbau ihrer heimischen Verteidigungsindustrie bei gleichzeitiger Beibehaltung wichtiger amerikanischer Technologie –, schränkt sie ihre Ausgaben für US-Waffen im Rahmen einer wichtigen gemeinsamen Beschaffungsinitiative ein.
Als das 150-Milliarden-Euro-Kreditprogramm für militärische Beschaffungen im März vorgestellt wurde, sollte die volle Teilnahme auf EU-Staaten und enge Partner wie Norwegen und die Ukraine beschränkt werden. Großbritannien, Australien und Kanada haben sich um eine Vollmitgliedschaft bemüht, indem sie ein Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaftsabkommen mit der Union unterzeichnet haben, was eine Voraussetzung für die Aufnahme ist.
Es wird jedoch eine Obergrenze für den Kauf von militärischer Ausrüstung von Unternehmen aus Ländern geben, die nicht Mitglieder des Plans sind, einschließlich amerikanischer Firmen: nur 35 Prozent.
Einige Länder wollten diese Obergrenze noch weiter senken, um mehr Investitionen im eigenen Land sicherzustellen. Frankreich wollte die Beteiligung von Nicht-EU-Anbietern oder -Unternehmen auf maximal 15 Prozent beschränken, aber diese Beschränkung wurde in den Verhandlungen gelockert, sagte Grant.
Der heutige Streit erinnert an eine frühere Auseinandersetzung von 2017 bis 2021 um ein Programm namens „Ständige Strukturierte Zusammenarbeit”. Das Programm soll die Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften der EU fördern und unterstützt fast 60 Projekte in den Bereichen Cyber, militärische Mobilität, Logistikzentren, Satellitenkommunikation und gemeinsame Ausbildung.
Auch dieses Programm unterlag Beschränkungen und wurde kritisiert. Im Jahr 2021 erklärte sich die EU bereit, Drittländer auf Einzelfallbasis und nur in begrenztem Umfang ohne Entscheidungsbefugnis zuzulassen. Großbritannien wurde bisher noch nicht einmal eine begrenzte Teilnahme gewährt.
Für diejenigen, die Amerika mit Argwohn betrachten, stellt sich die Frage, ob solche gemeinsamen Initiativen ausreichen werden, um die europäische Industrie in der Technologiekette nach vorne zu bringen. Das Risiko besteht darin, dass die bevorstehende Ausgabenwelle das bestehende System perpetuiert, in dem Europa eine Vielzahl von Haubitzen und Munition produziert, während es sich in Bezug auf fortschrittliche Fähigkeiten auf die Vereinigten Staaten verlässt.
 Einige Experten sind hoffnungsvoll. Die tiefe militärische Abhängigkeit von amerikanischer Technologie sei „in diesen Zeiten besorgniserregend“, sagte Guntram Wolff, Senior Fellow beim Think Tank Bruegel und Professor an der Université Libre de Bruxelles in Belgien.
Einige Experten sind hoffnungsvoll. Die tiefe militärische Abhängigkeit von amerikanischer Technologie sei „in diesen Zeiten besorgniserregend“, sagte Guntram Wolff, Senior Fellow beim Think Tank Bruegel und Professor an der Université Libre de Bruxelles in Belgien.
„Mittelfristig geht es wirklich darum, Europa von der technologischen Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten zu befreien“, sagte er. Obwohl ein solcher Übergang nicht über Nacht möglich sei, sei er zuversichtlich, dass die europäischen Länder in den nächsten fünf Jahren erhebliche Fortschritte erzielen werden.
Steven Erlanger ist Chefkorrespondent für Außenpolitik in Europa und lebt in Berlin. Er hat aus über 120 Ländern berichtet, darunter Thailand, Frankreich, Israel, Deutschland und die ehemalige Sowjetunion.
Jeanna Smialek ist Büroleiterin der Times in Brüssel.
Ende der Übersetzung
Beiträge und Artikel anderer Autoren müssen nicht die Sichtweise des Webseiteninhabers widerspiegeln, sondern dienen nur der vergleichenden Information und Anregung zur eigenen Meinungsbildung.

